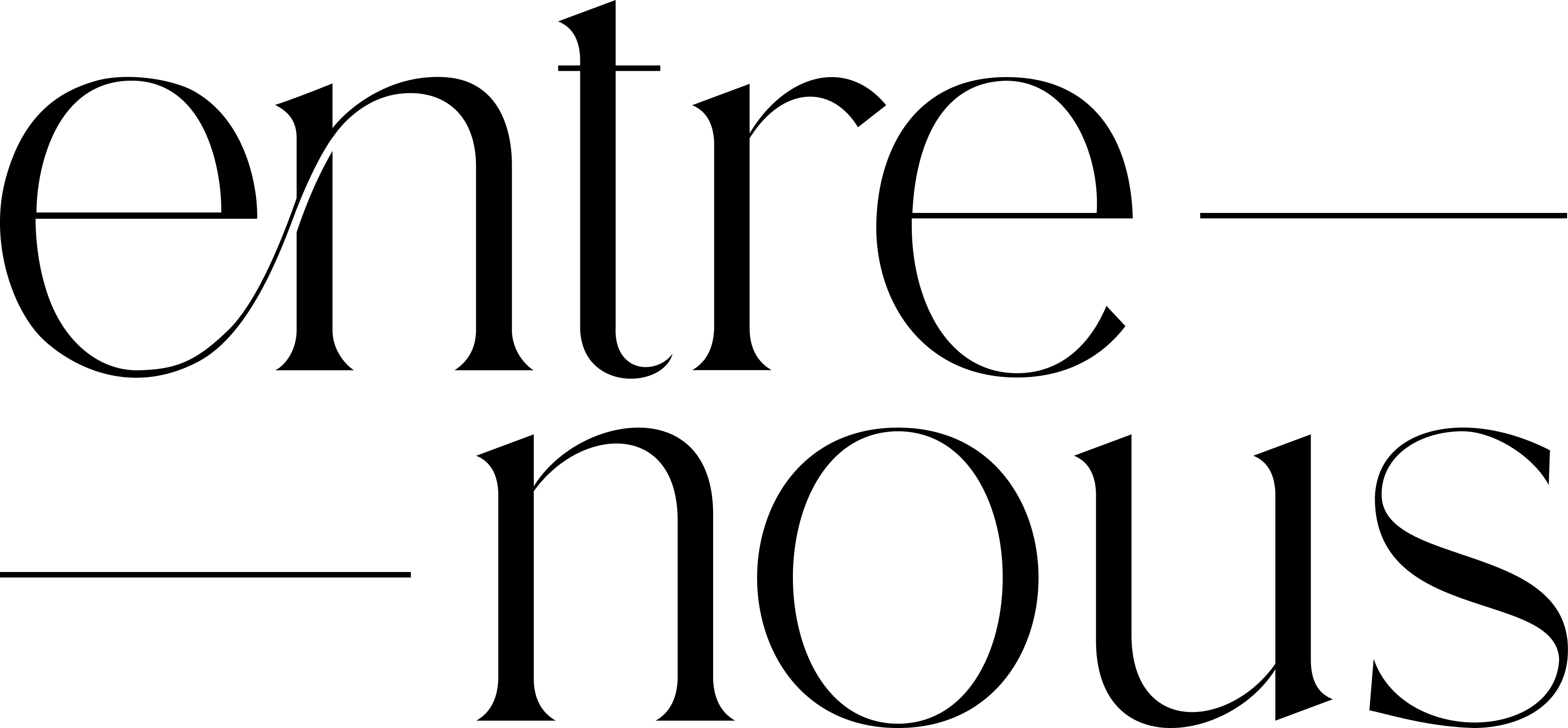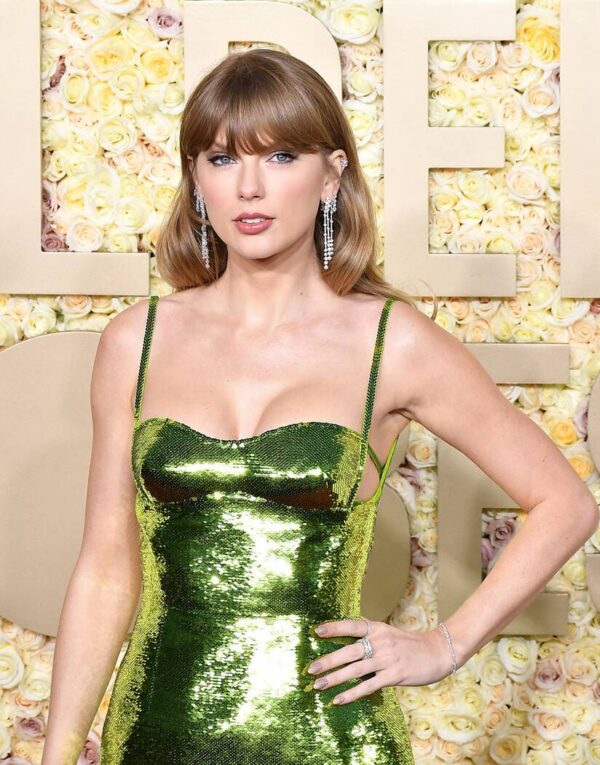20 Jahre Konsumkritik: 20 Jahre PRADA Marfa

Von Weitem wirkt es wie eine Fata Morgana. Eine kleine Boutique, makellos weiß, mit dem vertrauten Logo in schwarzen Lettern: PRADA. Dahinter: nichts. Kein Dorf, keine Menschen, nur Wüste, Wind und endloser Horizont. Wer auf dem Highway 90 durch West Texas fährt, stößt plötzlich auf dieses stille Rätsel. Prada Marfa, eine Kunstinstallation, die vor zwanzig Jahren errichtet wurde – und seitdem mehr über uns erzählt, als ihr Schöpferduo je hätte ahnen können.
Das Statement: ein Schaufenster voller Luxusgüter, gefüllt mit echten Prada-Handtaschen und Schuhen – aber ohne Tür, ohne Zugang, ohne Verkauf. Eine Luxusruine im Entstehen, gebaut, um langsam zu verfallen. Der Gedanke war simpel und brillant zugleich. Das Absurde des Konsums auszustellen, dort, wo niemand konsumieren kann. Doch es wurde zur Pilgerstätte einer anderen Konsumkultur.
Fünf Jahre vor Instagram hat es wohl kaum mit der Aufmerksamkeit gerechnet, die man wenige Jahre später mit einem solchen Objekt in Zeiten der Aufmerksamkeitskommodifizierung erreichen kann. Von Beyoncé bis hin zu x-beliebigen Influencerinnen und Influencern fuhren in den letzten zwanzig Jahren Tausende in die Einöde, um sich vor dem Kunstwerk fotografieren zu lassen. Die Ironie ist vollkommen: Ausgerechnet das Kunstwerk, das den Kult um Marken anprangerte, wurde zur Marke seiner selbst.
Doch vielleicht liegt genau darin seine Kraft. Prada Marfa hat etwas geschafft, was den meisten zeitgenössischen Installationen verwehrt bleibt: Es wurde Teil der kollektiven Bildsprache. Es steht für Widerspruch, für die Sehnsucht nach Bedeutung in einer durchgestylten Welt. Und es zeigt, dass Kunst längst nicht mehr im Museum stattfindet, sondern auf der Straße, im Feed – oder einfach im Vorbeifahren.
„Wir wollten ein Werk schaffen, das sich wie eine Ruine der Zukunft anfühlt – ein Luxusgeschäft, das niemand betreten kann, mitten im Nirgendwo“, sagte einer der Künstler, Michael Elmgreen, 2005 in einem Interview. Zwanzig Jahre später ist dieser Fall eingetreten. Prada Marfa wirkt mehr denn je wie ein Denkmal für die Fragilität unserer Welt. Es ist weder Werbung noch Antiwerbung, weder Ruine noch Laden. Es steht da, unbeweglich und stumm, während sich alles um es herum verändert.

Die Sonne bleicht die Wände, der Staub legt sich auf die Scheiben und die Produkte hinter dem Glas. Szenen, die man sonst nur hinter Demarkationslinien kennt – wie auf Zypern oder in atomar verseuchten Gebieten, die heute Pilgerstätten für Katastrophentourismus geworden sind. Der Besuch von Prada Marfa birgt allerdings keine Gefahr. Nur die der Vergegenwärtigung der Vergänglichkeit.
Damit gewinnt das Kunstwerk eine neue Deutungsmöglichkeit: Was bleibt von uns, unserer Welt und dem, was wir geschaffen haben, übrig, wenn wir einmal nicht mehr hier sind?
Denkmal der Widersprüche
Der Schrein des Überflusses, der ohne weiteren Referenzpunkt mitten in eine Einöde verpflanzt wurde, macht das Werk so stark. Keine Stadt, kein Publikum, keine Bewegung. Nur Rinderherden, die dahinter grasen, Wind und Stille. Hier verliert der Luxus seine Bedeutung. Das Objekt der Begierde steht da, von aller Begierde verlassen.
Wenn also Menschen Hunderte Kilometer dorthin fahren, nur um als Beweis für ihr „Dagewesensein“ ein Foto davor zu machen, halten sie die Bedeutungsleere unserer Konsumgesellschaft fest. Damit wirkt es wie ein unverstandenes Meme, das zugleich Projektionsfläche für all das ist, was sich viele von Konsum erwarten: Schönheit, Sinn und ein bisschen Trost im Angesicht der Vergänglichkeit.
Vielleicht ist das die letzte Ironie dieser Installation: dass sie, obwohl sie über das Ende des Konsums spricht, selbst unsterblich geworden ist. Ein Ort, der nichts verkauft und doch alles sagt. Ein Schaufenster in die Zukunft, das uns zurückblicken lässt – auf uns selbst, auf unsere Sehnsüchte, auf das, was wir für wichtig hielten.
Oder, wie es Ingar Dragset 2015 gegenüber dem Interview Magazine ausdrückte:
„Es ist faszinierend: Die Leute kommen für ein Selfie und merken gar nicht, dass sie Teil des Kunstwerks werden. Sie performen die Idee, die wir kritisieren wollten.“
Abonniere unseren EntreNousLetter und bleibe am neuesten Stand. Verpasse keine Updates über Mode, Kunst, Beauty & Lifestyle!