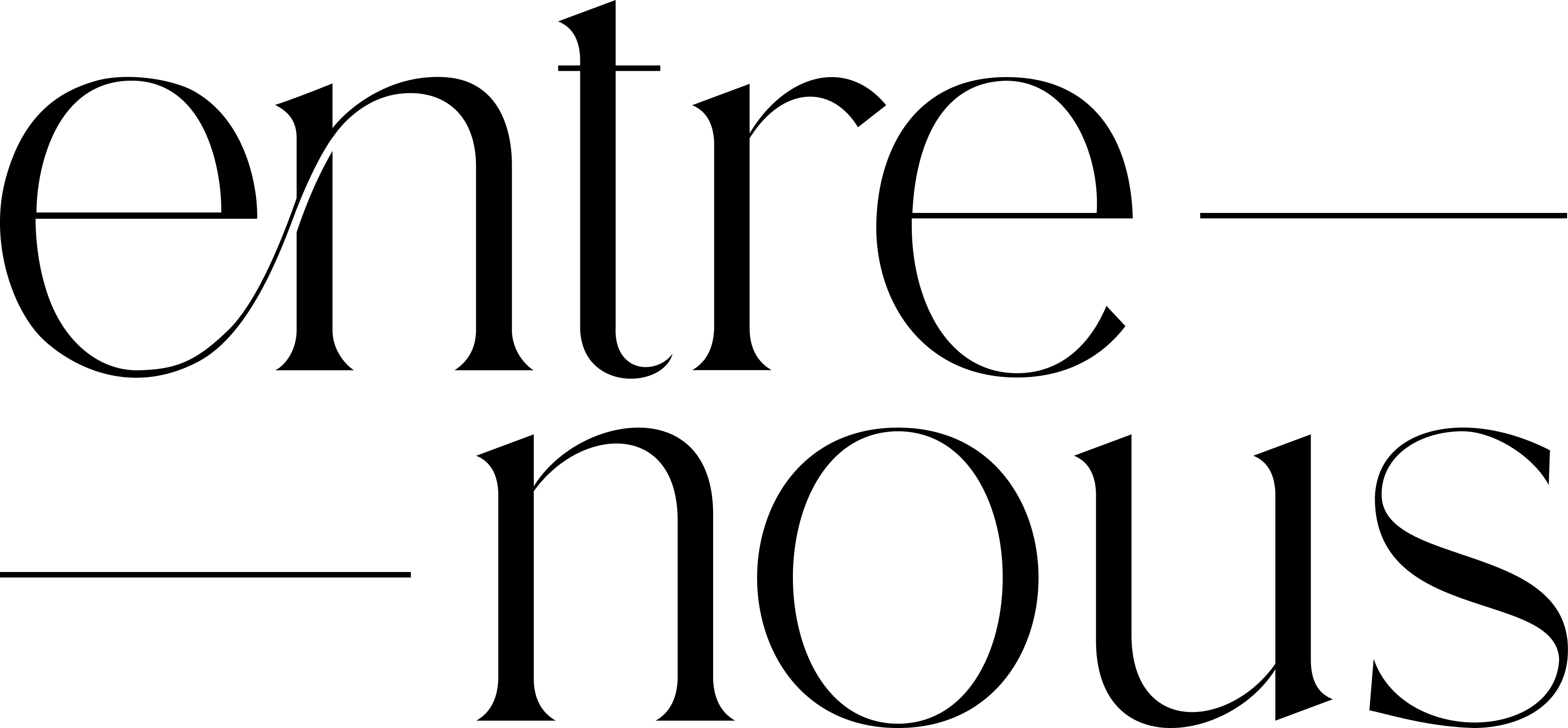Alphatiere der 2000er: Warum Fabrizio Corona wie ein Relikt wirkt
Fabrizio Corona war nie nur ein Promi-Agent. Er war nicht einmal ein Paparazzi selbst; er dirigierte allerdings das Bild dieser bis ins kleinste Detail.
Corona war und ist das sichtbarste Produkt eines Mediensystems, das den Skandal nicht als Ausrutscher verstand, sondern als Betriebsmodus. Geboren 1974 in Catania, Sohn eines angesehenen Journalisten, wuchs Corona in einer paradoxen Mischung aus Nähe zur Macht und radikaler Grenzüberschreitung auf. In den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren wurde er in Mailand zur zentralen Figur der italienischen Paparazzi-Szene – als Chef der Agentur Corona, die kompromittierende Bilder von Politiker:innen, Sportlern und Showgrößen sammelte, verkaufte oder gezielt nicht veröffentlichte (und die abgebildeten Personen dafür große Summen zahlen ließ).
Das System funktionierte nach einer einfachen Logik: Öffentlichkeit als Druckmittel.
Diese Logik fiel nicht vom Himmel. Sie passte perfekt in das Italien der Berlusconi-Jahre. Silvio Berlusconi hatte das Land seit den 1980ern medienpolitisch umgebaut: Privatfernsehen, Unterhaltung als politisches Vehikel, Celebrity-Kultur als Legitimation der Macht. Berlusconi war Medienunternehmer, Politiker und Popfigur – eine Konstellation, die Öffentlichkeit und Privatheit systematisch entgrenzte. Politik wurde persönlich, das Persönliche politisch. In diesem Klima war der Paparazzo kein Störenfried, sondern ein funktionaler Akteur.
Fabrizio Coronas Netflix-Serie: der Narziss ohne Reue
In der Netflix-Dokumentation Paparazzi: Re dei paparazzi erscheint Fabrizio Corona nicht als geläuterter Zeitzeuge, nicht als Mann, der zurückblickt und Bilanz zieht – sondern als jemand, der weiterhin auf der Bühne steht, als wäre sie nie geschlossen worden. Corona ist hier kein Objekt der Analyse, sondern ihr lautester Akteur. Er kommentiert sein eigenes Leben, bewertet seine Skandale, relativiert seine Urteile – und verweigert konsequent das, was klassische True-Crime-Formate oft erwarten: Reue.
Wer ist Fabrizio Corona?
Fabrizio Corona (geb. 1974, Catania) wurde Anfang der 2000er als „Re dei paparazzi“ bekannt. Gründer der Agentur Corona’s, baute ein System aus Paparazzi-Fotos, Exklusivverkäufen und Erpressung auf. Bewegte sich im Umfeld von Politik, Sport und Showbusiness, profitierte vom Berlusconi-Medienklima. 2007 Verhaftung, mehrere Verurteilungen (u. a. Erpressung). Haft, mediale Comebacks, Selbstinszenierung als Opfer und Provokateur. 2023 Rückkehr ins Rampenlicht durch Netflix-Doku Paparazzi: Re dei paparazzi.
Selbst wenn Fabrizio Corona 2003 an der Aufdeckung von Wettskandalen beteiligt war – einem Moment, in dem er sich kurz als Störenfried eines korrupten Systems inszenieren konnte –, bleibt er vor allem eines: ein Interrupter. Einer, der nicht aus Überzeugung eingreift, sondern weil sich im Riss des Systems Macht gewinnen lässt.
Corona ist kein Aufklärer, sondern ein Aufmischer mit feinem Gespür für den richtigen Moment. Er erkennt Instabilität wie andere den Wetterumschwung – und setzt genau dann auf Angriff.
Was die Serie dabei so irritierend macht, ist nicht die Offenheit, mit der Corona über Macht, Geld und Erpressung spricht, sondern die Selbstverständlichkeit, mit der er sich selbst ins Zentrum jeder moralischen Erzählung rückt. Alles, was passiert ist, wird durch sein Ich gefiltert. Opfer kommen vor, aber selten als Subjekte; sie bleiben Randfiguren in seiner Geschichte. Schuld ist nie eindeutig, Verantwortung nie eindeutig bei ihm. Stattdessen: ein permanentes Narrativ der Rechtfertigung. Wenn er Schaden angerichtet hat, dann weil „Alle es so gemacht haben“.
Psychologisch lässt sich dieses Auftreten kaum übersehen: Corona inszeniert sich als unangepasster Überlebender, als jemand, der den Mut hatte, das auszusprechen und zu tun, was andere nur heimlich wollten. Die Serie zeigt ihn als Mann, der Bewunderung erwartet – selbst dort, wo Distanz angebracht wäre. Narzissmus ist hier nicht bloß eine Charaktereigenschaft, sondern ein Arbeitsprinzip. Er braucht das Gegenüber, um sich selbst zu bestätigen, und die Kamera, um seine Existenz zu legitimieren. Schweigen würde für ihn einen Bedeutungsverlust bedeuten.
Auffällig ist dabei, wie sehr Corona an einem überholten Bild von Männlichkeit festhält. Stärke bedeutet für ihn Kontrolle, Dominanz und Unverletzlichkeit. Zweifel, Empathie oder Selbstkritik tauchen höchstens strategisch auf – nie als echte Brüche. Wenn er von Haft, Isolation oder öffentlicher Ächtung spricht, dann nicht als Lernmoment, sondern als Beweis seiner besonderen Stellung: Ich habe mehr ertragen als andere. Leiden wird zur Auszeichnung, nicht zur Reflexion.
Er entschuldigt sich nicht gegenüber seiner Ex-Frau, die er zur Abtreibung zwang, damit sie als damaliges Model mehr Auftritte machen konnte, noch geheim oben ohne an die Paparazzi im Gebüsch zu verkaufen, indem er ihnen den Tipp gab, wo sie Urlaub machte. Anmerkung: Er war mit ihr auf Urlaub.
Fiat, Agnelli – und Coronas Grenzüberschreitung
Der vielleicht kälteste Moment der Netflix-Serie ist jener, in dem Fabrizio Corona von einem Skandal erzählt, der selbst im zynismusgeübten Italien der 2000er-Jahre als Tabubruch galt: der Fall rund um die Familie Fiat und die Agnellis. Konkret ging es um Bilder und Gerüchte im Umfeld eines schwerkranken, komatösen Patienten aus dem engsten Kreis der italienischen Industriearistokratie – ein Moment, in dem selbst das sonst so elastische moralische Gummiband des Boulevards riss.
Gerade hier zeigt sich Coronas Selbstbild besonders deutlich. Er inszeniert sich in der Serie wie ein besser aussehender Sylvester Stallone in einem italienischen Gefängnisfilm: der Körper gestählt, gebräunt, unter Kontrolle – selbst hinter Gittern. Der eigene Körper wird zur letzten Bastion der Macht, zur visuellen Widerlegung von Schuld und Niederlage. Während andere Reue zeigen, zeigen Muskeln. Wo Verantwortung erwartet wird, liefert er Pose, kaugummikauend sogar vor dem Richter.
Diese Körperinszenierung ist kein Zufall, sondern Teil derselben Logik, die auch den Agnelli-Skandal ermöglicht hat. Wer den Körper des Anderen zum Objekt macht, muss den eigenen permanent als Beweis seiner Überlegenheit ausstellen. Stärke ersetzt Reflexion. Härte ersetzt Einsicht. Corona bleibt auch hier konsequent: Der Skandal wird nicht als moralisches Versagen erzählt, sondern als Beleg für seine Radikalität. Ich bin weitergegangen als alle anderen – das ist die unausgesprochene Pointe.
Dass dieser Moment heute besonders verstört, liegt an der zeitlichen Verschiebung. Was damals als „zu weit gegangen“ galt, erscheint heute als ethischer Totalschaden. Nicht, weil Grenzen erst jetzt existieren – sondern weil sie heute öffentlich verhandelt werden. Der Agnelli-Fall markiert rückblickend einen Kipppunkt: den Moment, in dem das alte Einverständnis zwischen Macht, Medien und Schweigen endgültig zerbrach.
Corona jedoch bleibt stehen. In seiner Zelle, im Scheinwerferlicht, im eigenen Körper. Er wirkt wie ein Mann, der nie gelernt hat, dass Stärke nicht darin besteht, alles zu nehmen – sondern darin, manches nicht anzurühren.
Der Bad Boy als peinlicher Akt
Und dann passiert beim Zuschauen etwas Seltsames: Coronas Bad-Boy-Image wirkt nicht mehr gefährlich – sondern oft einfach unpassend. Wie ein schlecht sitzender Anzug aus einer anderen Zeit. Nicht, weil es heute weniger Machismo gäbe. Sondern weil sich das Drehbuch für Männlichkeit in knapp 20 Jahren neu sortiert hat.
Die Doku zeigt nicht nur einen Mann, der sich selbst zur Marke gemacht hat, sondern auch, wie Männlichkeit als Performance funktioniert – damals wie heute. Nur dass „Bad Boy“ inzwischen schneller kippt: von „gefährlich“ zu „peinlich“, von „dominant“ zu „unsicher“, von „Skandal“ zu „Cringe“. Das neue Männerbild – auch in Italien – ist nicht automatisch besser, nicht automatisch feministischer, nicht automatisch sanfter; es wird aber stärker beobachtet. Und in dieser Beobachtung liegt die eigentliche Machtverschiebung.
Abonniere unseren EntreNousLetter und bleibe am neuesten Stand. Verpasse keine Updates über Mode, Kunst, Beauty & Lifestyle!