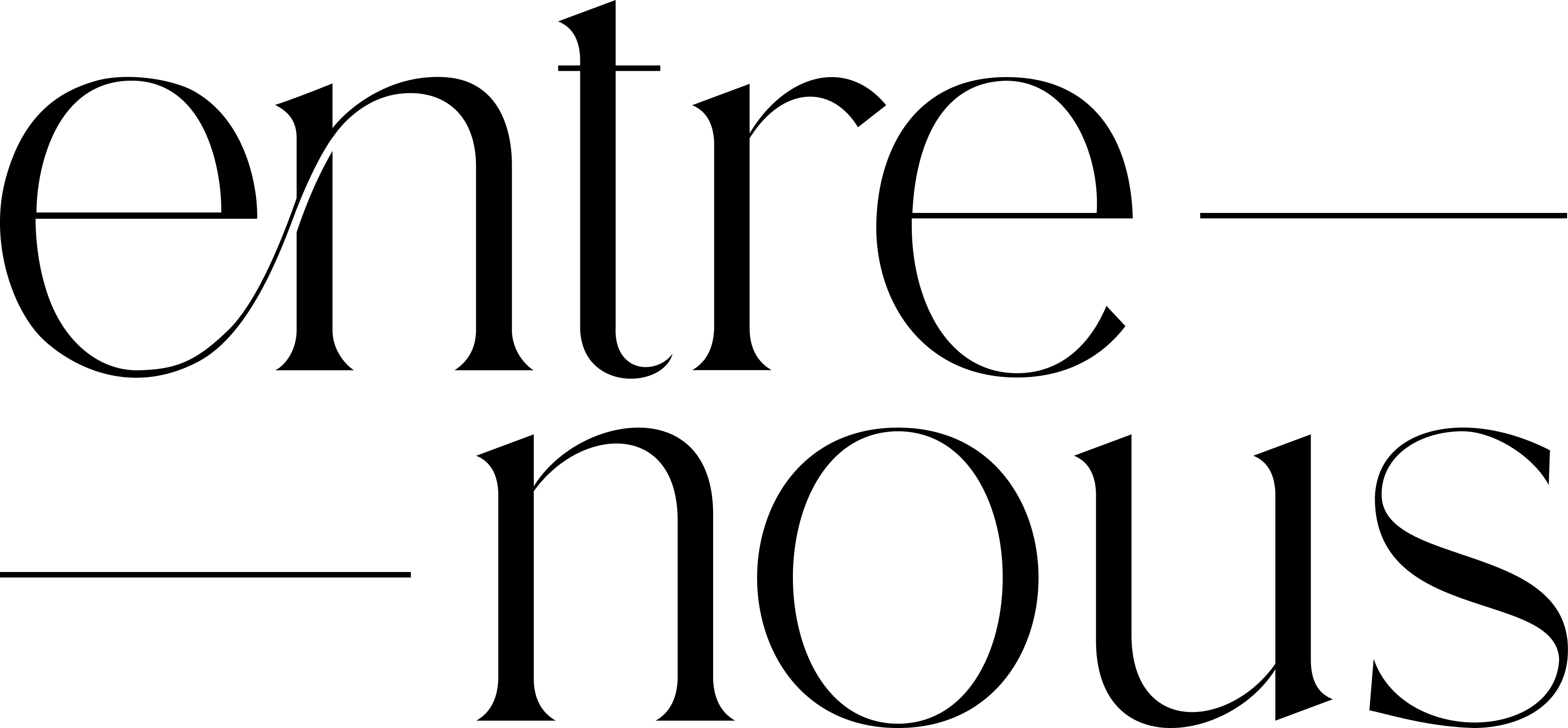Wenn Zahlen sexistisch sind: Das Problem geschlechtskodierter Identifikationssysteme

In vielen Ländern verrät eine offizielle Identifikationsnummer mehr, als sie sollte. Hinter einer scheinbar neutralen Zahlenfolge verbergen sich persönliche Daten wie Geburtsdatum, Herkunft – oder sogar das Geschlecht.
Jahrzehntelang galt die Praxis, „01“ für Männer und „02“ für Frauen zu verwenden, als harmlos und praktisch.
Doch in einer Zeit, in der Geschlechtervielfalt und Gleichberechtigung anerkannt werden, wird diese Praxis zunehmend als sexistisch, überholt und ausgrenzend kritisiert.
Wenn zahlen sexistisch werden: Ein Erbe bürokratischer Einfachheit
Als nationale Identifikationssysteme Mitte des 20. Jahrhunderts eingeführt wurden, war die Welt in einfachen Gegensätzen gedacht: Mann und Frau, arbeitend und nicht arbeitend, Bürger und Ausländer. Die Kodierung des Geschlechts in der ID-Nummer schien ein nützliches Instrument, um Bevölkerungsstatistiken, Wehrpflicht oder Rentenverwaltung zu vereinfachen.
So verwendet etwa die französische INSEE-Nummer oder die südkoreanische Registrierungsnummer ein bestimmtes Ziffernmuster, um das Geschlecht zu kennzeichnen: ungerade Zahlen für Männer, gerade für Frauen. Die Absicht war meist rein administrativ – doch gute Absichten machen ein System nicht automatisch gerecht.
Die versteckte Hierarchie von „01 = Mann, 02 = Frau“
Was neutral erscheint, ist oft nicht neutral. Indem Männern der Code „01“ und Frauen der Code „02“ zugeordnet wird, wird der Mann implizit als „Standard“ und die Frau als „zweite Kategorie“ dargestellt. Diese Reihenfolge ist kein Zufall – sie spiegelt gesellschaftliche Machtverhältnisse wider, die tief in die Bürokratie verankert sind.
Darüber hinaus zementiert sie eine starre Geschlechterbinarität. Menschen, die sich nicht eindeutig als männlich oder weiblich identifizieren – etwa nicht-binäre, trans oder intersexuelle Personen – finden in einem solchen System keinen Platz. Für sie wird die Identifikationsnummer zum Symbol der Unsichtbarkeit: Das System signalisiert ihnen, dass ihre Existenz nicht vorgesehen ist.
Wenn Verwaltung Diskriminierung produziert
Geschlechtskodierte Identifikationsnummern sind ein Beispiel für strukturellen Sexismus – Diskriminierung, die nicht auf individueller Absicht, sondern auf institutionellen Regeln beruht.
Wer eine solche Nummer besitzt, muss sein Geschlecht offenbaren, auch wenn sie für den Zweck der Identifikation keinerlei Relevanz hat. Das kann Folgen haben: In Bewerbungsverfahren, bei Versicherern oder im Gesundheitswesen wird das Geschlecht oft sofort erkennbar – und kann unbewusst Entscheidungen beeinflussen. So wird aus einem bürokratischen System ein Mittel, das Ungleichheit reproduziert.
Frankreich, Rumänien, Italien – drei Varianten des alten Denkens
Frankreich
In Frankreich wird das Geschlecht direkt durch die erste Ziffer der INSEE-Nummer angezeigt: 1 steht für Männer, 2 für Frauen.
Was in den 1940er-Jahren als schlicht und zweckmäßig galt, wirkt heute wie eine in Zahlen gegossene Erinnerung an binäre Denkweisen – an eine Zeit, in der es nur zwei gesellschaftlich anerkannte Geschlechter gab.
Rumänien
Auch in Rumänien ist das Geschlecht Teil der persönlichen Kennung. Der CNP (Cod Numeric Personal) besteht aus 13 Ziffern, deren erste Zahl sowohl das Jahrhundert als auch das Geschlecht angibt:
- Männer : 1, 3, 5 oder 7
- Frauen : 2, 4, 6 oder 8
Es folgen das Geburtsdatum (JJMMTT), die regionale Codes und eine Prüfziffer.
Der CNP wurde 1978 eingeführt – in einer Ära, die nur zwei Geschlechtskategorien kannte. Bis heute gibt es keine offizielle Möglichkeit, darin ein drittes oder ein neutrales Geschlecht einzutragen.
Italien
In Italien läuft es subtiler – und, man könnte sagen, eleganter. Der Codice Fiscale (Steueridentifikationsnummer) verrät das Geschlecht nicht direkt, sondern indirekt, mathematisch-clever, über das Geburtsdatum.
Die beiden Ziffern für den Tag der Geburt (Position 10–11) unterscheiden Männer und Frauen:
- Männer : tatsächlicher Geburtstag (z. B. 15)
- Frauen : Geburtstag + 40 (z. B. 55 für eine Frau, geboren am 15.)
So erkennt das System das Geschlecht nur anhand einer kleinen Variation im Datum – eine diskrete, typisch italienische Lösung. Viele sehen darin einen Fortschritt gegenüber Systemen wie in Frankreich oder Rumänien, weil das Geschlecht hier nicht sofort ins Auge fällt.
Doch auch dieses „gute italienische System“ bleibt letztlich binär: Es kennt nur Mann und Frau und bietet keine Möglichkeit, genderfluide oder nicht-binäre Identitäten korrekt abzubilden. Zwar hat das italienische Verfassungsgericht 2024 das Recht auf nicht-binäre Identität bestätigt, doch fehlt bislang eine gesetzliche Grundlage, um diese Vielfalt auch im Codice Fiscale sichtbar zu machen.
Von bürokratischer Neutralität zu strukturellem Sexismus
Die Einbettung des Geschlechts in Identifikationsnummern ist ein Beispiel für strukturellen Sexismus – also Diskriminierung, die durch institutionelle Regeln und Verwaltungslogik entsteht. Sie zwingt Menschen dazu, ihr Geschlecht offenzulegen, selbst wenn dies für die Identifikation völlig irrelevant ist.
In der Praxis kann dies zu Diskriminierung führen: etwa bei Bewerbungen, Versicherungen oder im Gesundheitswesen, wo das Geschlecht durch die Nummer sofort erkennbar wird. So wird die ID-Nummer zu einem Werkzeug, das Ungleichheit unwillkürlich reproduziert.
Weltweite Reformen für mehr Inklusion
Einige Länder haben begonnen, ihre Systeme zu modernisieren:
- Deutschland und Nepal führen eine dritte Geschlechtsoption („divers“ bzw. „andere“) ein.
- Die Niederlande planen, bis 2030 das Geschlecht vollständig aus Ausweisdokumenten zu entfernen.
- Kanada und Neuseeland erlauben bereits die Aufdruckung eines „X“ als Geschlechtskennzeichnung auf Pässen.
Diese Entwicklungen zeigen: Geschlechtsidentität ist persönlich, nicht administrativ. Eine staatliche Nummer sollte Menschen nicht kategorisieren, sondern lediglich identifizieren.
Zeit für geschlechtsneutrale Identifikatoren
Ein modernes Identifikationssystem sollte allein der eindeutigen Zuordnung dienen – nicht der Klassifizierung. Zufällig oder neutral generierte Nummern können Menschen problemlos identifizieren, ohne dabei ihr Geschlecht, ihre Herkunft oder andere Merkmale preiszugeben.
Der Wandel hin zu geschlechtsneutralen Systemen ist kein Akt politischer Korrektheit, sondern ein Ausdruck von Fairness, Datenschutz und Menschenwürde.
Zahlen sollten keine Identität festlegen – sie sollten ihr dienen.
Abonniere unseren EntreNousLetter und bleibe am neuesten Stand. Verpasse keine Updates über Mode, Kunst, Beauty & Lifestyle!