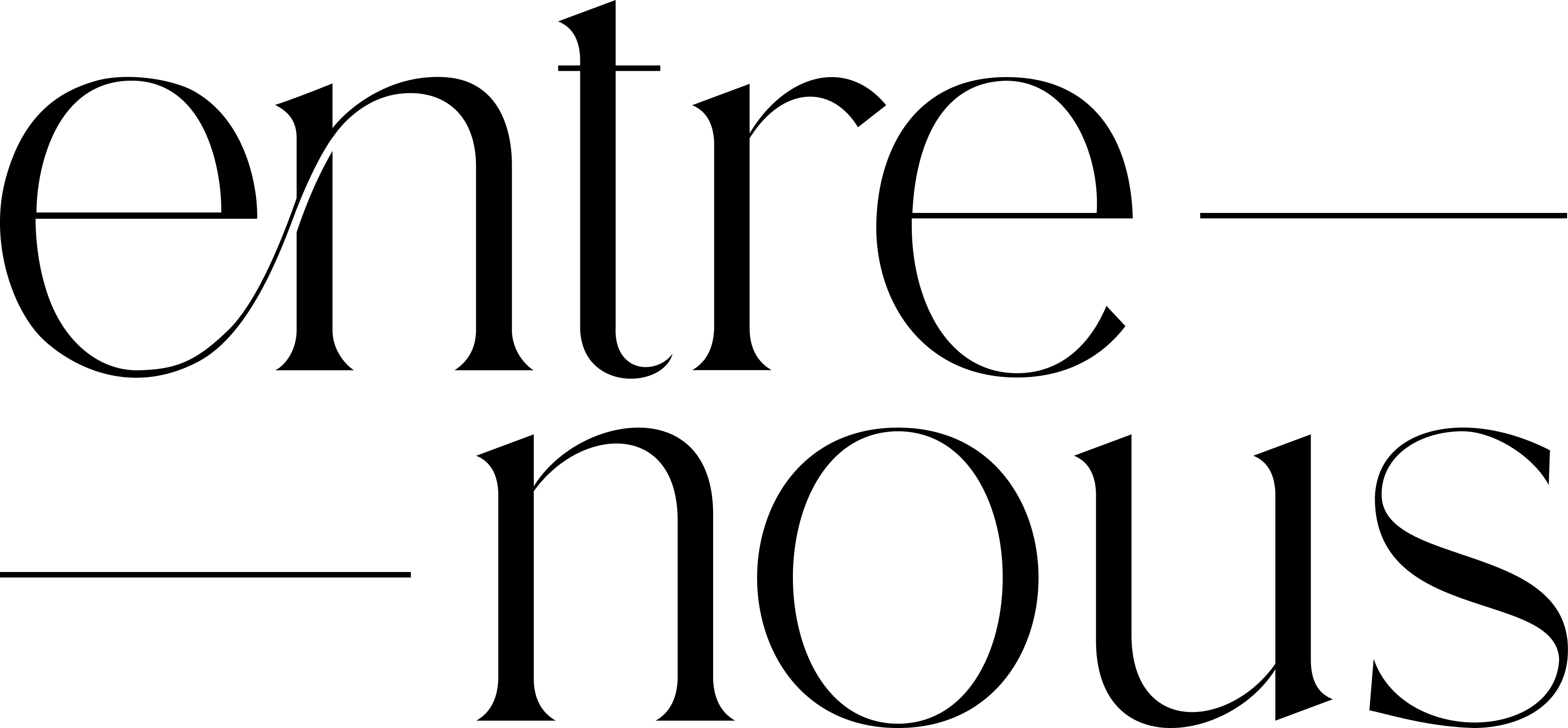Toxic Masculinity: Warum fühlen sich so viele Männer bedroht?

In einer Welt voller widersprüchlicher Erwartungen an Männer – stark, dominant, gleichzeitig sensibel und gleichberechtigt zu sein – geraten viele ins Wanken. Diese Orientierungslosigkeit ist der Nährboden für Männlichkeitsideale, die durch verschiedene Online-Plattformen und Communities im digitalen Raum rascher und intensiver denn je verbreitet werden und mit gewaltvollen Konnotationen einhergehen. Ein Problem, das weitreichende Konsequenzen für die Gesellschaft mit sich bringt.
Der Begriff “toxische Männlichkeit” wird auf Plattformen wie TikTok, YouTube und Instagram mittlerweile inflationär verwendet. Doch hinter diesem Buzzword steckt mehr als nur dicke Autos, Muskelbilder und das Nichtteilen von Emotionen.
laura schramböck
Laura Schramböck schrieb diesen Artikel. Er wurde im EntreNous HOM:ME #1 veröffentlicht.
“Toxische Männlichkeit” bezeichnet gesellschaftlich vermittelte Normen, die Eigenschaften wie emotionale Unverwundbarkeit, Aggression, Dominanz und Misogynie idealisieren. Durch die Verbreitung dieser sind Männer zunehmend dem Druck unterlegen, gewisse “typisch männliche” Eigenschaften zu erfüllen, der sich in emotionaler Unterdrückung, gesteigerter Aggression und Frauenfeindlichkeit, psychischen Erkrankungen, sozialer Isolation und in extremen Fällen auch realer Gewalt manifestiert. Auch die American Psychological Association (APA) warnte 2018 in neuen Leitlinien davor, dass diese Stereotype zu psychischen Problemen, Gewalttaten und Ungleichheit beitragen.
Ein Ritt durch die Manosphere
Unsere digitale Welt, die das Verbreiten solcher Ideale in Sekundenschnelle ermöglicht, ist dazu der Katalysator. Besonders einflussreich ist die Manosphere, die bereits die Aufmerksamkeit der UNO hat. Diese ist eine Internetbubble, in der auf verschiedenen Websites und Blogs Inhalte geteilt werden, die hegemoniale Maskulinität in den Fokus rücken und die übergreifende Ansicht vertreten, dass die Gesellschaft aufgrund feministischer Einflüsse Männern gegenüber voreingenommen ist und Feministinnen Männerhass fördern, was dazu führe, dass sie gesellschaftlich benachteiligt würden.

Incel Kultur: Nur eine virale Community?
Die Manosphere ist vorwiegend (aber nicht nur!) im rechtspolitischen Raum verankert. Sie zeichnet sich durch die Glorifizierung der Gewalt an Frauen aus und wird mit Onlinebelästigung assoziiert, die sich in Hasskommentaren spiegeln, die oft Vergewaltigungsfantasien beinhalten.
Doch woraus besteht die Manosphere? Zentral ist die Subkultur der Incels. Eine Abkürzung für die Bubble der “involuntary celibate”. Dieser Begriff bezeichnet Männer, die nach Eigenaussage unfreiwillig keinen Geschlechtsverkehr haben. Ursprünglich im Jahr 1997 von einer kanadischen Studentin als unterstützende Community für schüchterne Menschen ins Leben gerufen, entwickelte sich daraus eine frauenfeindliche Bewegung, die nachweislich mit verschiedenen Gewalttaten – darunter Anschläge und Messerattacken – gegenüber Frauen in Verbindung steht und Attentäter zu Helden stilisiert. Studien zeigen, dass von etwa 3 Millionen sexlosen US-Männern im Alter zwischen 22 und 34 Jahren rund 100.000 aktiv in Incel-Onlineforen unterwegs sind.
Meist sind es ältere Männer, die den harten Kern des Sexismus in der Gesellschaft bilden.
Dass die Manosphere bei der öffentlichen Diskussion über sie kein Mittelmaß kennt, zeigte sich erst letztens an den heftigen Reaktionen zur britischen Netflix-Serie Adolescence. Diese hat den fiktiven Fall eines 13-Jährigen zum Inhalt, welcher die gefährliche Dynamik digitaler Radikalisierung zeigt. (Achtung Spoiler!) Erst nach dem Mord an einer Mitschülerin entdeckt das erwachsene Umfeld des Jungen seine Radikalisierung, die zur Tat geführt haben.
Der Plot basiert auf wahren Fällen in Großbritannien, welche von den Serienmachern auf einen gemeinsamen Nenner gebracht wurden: Ein junger Mann wird zurückgewiesen, radikalisiert sich und begeht einen Femizid. Dass die Serie für eine große gesellschaftliche Debatte in der britischen Gesellschaft sorgte und sogar Premierminister Sir Keir Starmer einbezog, zeigt den Bedarf an einer Positionierung gegenüber dem Problem.
Doch sind es wirklich immer “nur” junge Männer, deren Lebensfrust sich über Communities auf Social Media entlädt und die Frauenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft aufleben lassen?
Laut The Guardian äußert Prof. Michael Salter von der University of New South Wales Zweifel daran, dass junge Männer heute misogyner seien als frühere Generationen. So sähe er keine Belege dafür, dass junge Männer frauenfeindlicher wären als vor 20 oder 30 Jahren. Vielmehr seien es meist ältere Männer, die den harten Kern des Sexismus in der Gesellschaft bilden. Salter erinnert sich an seine eigene Schulzeit, in der sexuelle Belästigung weit verbreitet und normalisiert war.

Obwohl neue Phänomene wie Social Media oder Figuren wie Andrew Tate aktuell stark in den Fokus rücken, warnt Salter davor, dies als alleinige Erklärung für geschlechtsspezifische Gewalt von Jugendlichen zu sehen. Die Ursachen seien tieferliegend und komplexer. Selbst ohne soziale Medien gäbe es seiner Meinung nach weiterhin hohe Gewaltzahlen gegen Mädchen und Frauen, denn jugendliche Männer gehörten schon lange zur Risikogruppe für diese Form von Gewalt.
Die Dating-Kultur im radikalen Wandel
Doch Frauenfeindlichkeit steckt natürlich nicht nur in den Echo Chambers der Manosphere und verbleibt dort. Wie sie das Verhältnis zwischen Männern und Frauen vergiften kann, zeigt sich in puncto Datingkultur, die hier eine ganz eigene Form von “Gurus” auf den Plan gerufen hat: die Pick-Up Artists. Diese lehren Männer Strategien, um besonders “männlich” mit Frauen in Kontakt zu treten.
Die Routine ist dabei immer die gleiche und basiert auf psychologischer Manipulation und emotionalem Druck. Sie fördern ein Bild von Männlichkeit, das Frauen als “Beute” und Beziehungen als “Spiel” sieht. Dabei verbreiten sie den Mythos vom manipulierbaren, möglichst willenlosen, weiblichen Gegenüber, wie Dr. Rachel O’Neill von der Universität Warwick und Autorin von Seduction: Men, Masculinity and Mediated Intimacy erklärt. “Diese Coaches stützen sich auf die Prämisse, dass Interaktionen zwischen Männern und Frauen bestimmten zugrundeliegenden Prinzipien unterliegen.”
Zu den gängigen Methoden, die Pick-Up Artists lehren, gehören unter anderem “Negs” – subtile Beleidigungen oder zweideutige Komplimente, die das Selbstwertgefühl einer Frau untergraben sollen, um sie emotional aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ziel ist es, Unsicherheit zu erzeugen, damit sie empfänglicher für die anschließenden Avancen wird. Eine Art Speed Love Bombing, wie man es von Narzissten kennt.

Ein weiteres häufig eingesetztes Mittel ist das “Peacocking”, bei dem Männer sich besonders auffällig kleiden oder exzentrisch verhalten, um Aufmerksamkeit zu erregen und sich von anderen abzuheben. Dadurch soll ein Eindruck von Selbstbewusstsein und sozialem Status erzeugt werden – Eigenschaften, die laut der Pick-Up Logik Frauen automatisch anziehend finden. Schließlich werden diese ja auch als homogene “Masse” beschrieben, die diesen Taktiken auf den Leim gehen müssen.
Auch die sogenannte “Kino Escalation” – das schrittweise, oft ohne verbale Zustimmung erfolgende körperliche Annähern – ist ein typisches Element. Dabei wird der physische Kontakt bewusst forciert, um “Komfort” aufzubauen und Grenzen systematisch zu testen oder zu verschieben.
Nicht selten greifen Pick-Up Artists (wie könnte es anders sein) auf Konzepte wie das “Alpha Male” Narrativ zurück, das eine stark hierarchische, dominante Männlichkeitsvorstellung propagiert. Gefühle, Einvernehmlichkeit oder authentische Nähe werden als Schwäche abgewertet. Stattdessen gilt emotionale Distanz als Zeichen von Kontrolle. Somit wird emotionale Gewalt normalisiert und ein rückschrittliches Verständnis von Intimität reproduziert, wobei es letztlich nicht um eine zwischenmenschliche Verbindung geht – sondern um Kontrolle, Selbstbestätigung und Machtausübung.
Wie oft diese Strategie funktioniert, ist noch nicht in Studien belegt. Man kann sich nur sicher sein: Funktioniert es nicht, ist sicher nicht der Lehrmeister namens Pick-Up Artist, sondern das Objekt der Begierde Schuld gewesen.
Die Auswirkungen auf Frauen und Mädchen … im täglichen Leben
Die Autorin dieses Artikels hat eine solche “Anbahnung” einmal selbst in der Wiener Innenstadt nach dem Sport erleben müssen. In Richtung Straßenbahnstation unterwegs, Kopfhörer im Ohr, steuerte ein großer Mann plötzlich auf mich zu. “Hey!”, hörte ich ihn über die Melodie des Songs Don’t Call Me Angel (wie passend) von Ariana Grande rufen. “Du siehst aber sportlich aus. Wollen wir mal gemeinsam Sport machen? Ich geb’ dir auch Personal Training”, grinste er. Seine beiden Kumpels standen etwas abseits und beobachteten das Spektakel. Ich lehnte höflich ab, war aber sichtlich desinteressiert. Wäre für die meisten Männer die Konversation hier beendet, fängt für Pick-Up Artists und ihre Zauberlehrlinge das Spiel aber erst an.
Nachdem er es mit seiner vermeintlich charmanten Art nicht geschafft hatte, mich von sich zu überzeugen, ging er zum Angriff über. Meine Unsicherheit und Zurückhaltung würde zeigen, dass sich nicht viele Männer für mich interessieren – wäre ja auch kein Wunder. Seine Freunde schienen beeindruckt.
Obwohl ich mitten auf der Straße stand und sich viele Passant:innen um uns herum bewegten, kroch in mir die Angst hoch. Immerhin standen mir drei große und mittlerweile bedrohlich wirkende Männer gegenüber. Ich beschloss die Flucht anzutreten, setzte meine Kopfhörer wieder auf und machte mich schnell auf in Richtung Straßenbahn. Ich hörte noch, wie er mir etwas hinterherrief. Was genau es war, habe ich verdrängt. Positiv war es bestimmt nicht.
Ein Foto vom …
Neben unangenehmen Kontaktaufnahmen oder übergriffigen Kommentaren gibt es in der Sphäre des Online-Datings auch eine weitere gefürchtete Frucht toxischer Männlichkeit: Dick Pics. Wer einmal ungefragt ein Penisbild zugeschickt bekommen hat, kann sich vermutlich bis heute noch an die damit einhergehenden, beklemmenden und verstörenden Gefühle erinnern. Immerhin handelt es sich dabei um eine Form der digitalen sexuellen Belästigung, die im österreichischen Parlament gerade durch eine Gesetzesänderung zukünftig mit Strafe bedroht wird. Dass Online-Apps wie Tinder oder Bumble in den Chats das Versenden von Fotos unterbindet, geht auf das massenhafte Versenden dieser Nacktfotos zurück. Doch warum werden sie eigentlich verschickt?
In einer Studie mit über 1.000 heterosexuellen Männern konnte herausgefunden werden, dass die größten Antriebskräfte hinter dem Versenden solcher Bilder die Hoffnung auf eine Erregung des Gegenübers und auf entsprechende Bilder der anderen Person und damit eine Form der Selbstbestätigung sind.
Viel schockierender allerdings ist die Tatsache, dass 15 Prozent angaben, mit ihren Bildern bewusst zu provozieren oder sogar verletzen zu wollen und Dominanz herzustellen. Wenig überraschend also, dass eine weitere Studie herausfinden konnte, dass das Versenden von Dick Pics mit narzisstischen und sexistischen Persönlichkeitsmerkmalen korreliert.
Toxic Masculinity und die queere Community
Obwohl toxische Männlichkeit hauptsächlich im Bezug auf heterosexuelle cis Männer und Frauen diskutiert wird, ist die queere Community davon ebenso betroffen. Traditionell maskuline Ideale hindern auch hier viele daran, sich und ihre Identität auszuleben und erschweren dadurch den Fortschritt in Richtung einer inklusiveren Gesellschaft.
Hinzu kommt, dass auch – entgegen ihrer weltoffenen und diversitätsbegrüßenden Attribute, die der LGBTQIA+ Community zugeschrieben werden – queere Männer toxisch männliche Normen verfolgen können.
In ihrem Artikel Exploring Toxic Masculinity (erschienen im Title Mag) beschreibt die Autorin Laura Gruebler beispielsweise, dass queere Männer auf Dating Apps häufig nach “maskulinen” Partnern suchen und sexistische Terminologien wie “no femmes” verwenden. Warum diese Strukturen auch in der queeren Community wachsen, ist ungeklärt.
Nicht von der Hand zu weisen ist, dass sich toxische Maskulinität von den Fundamenten des Patriarchats ableitet und diese Glaubenssätze und Verhaltensweisen auch hier an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Queerness ist also kein automatischer Schutz vor genderbasierter Gewalt.
Gibt es Chancen auf Veränderung?
In einer Welt, in der der Einfluss digitaler Plattformen auf die Verbreitung toxischer Männlichkeitsideale immer stärker wird, wird die Notwendigkeit gezielter Interventionen immer lauter. Neben den Beschlüssen neuer Gesetze schlagen Psychologinnen, Soziologinnen und Philosophinnen verschiedene Maßnahmen zur Reduktion solcher Verhaltensweisen vor.
Angefangen vom Ausbau der psychologischen Betreuung über Bildungsarbeit im Bezug auf die Aufklärung über Geschlechterrollen und die Förderung von Empathie und emotionaler Intelligenz bis hin zu gezielten Online-Interventionen gibt es vielversprechende Ansätze. Hinzu kommt die Zielsetzung, extremistische Foren strikt zu regulieren oder Inhalte in sozialen Medien zu löschen. Digitale Radikalisierung jeder Richtung beginnt stets im Kleinen.
Deswegen ist es besonders wichtig, dass sich auf den genannten Schauplätzen, den sozialen Medien, auch positive Role Models Raum und Gehör verschaffen. Unter ihnen sind beispielsweise der Musiker, Schauspieler und Autor Jordan Stephens, der sich mit seiner Kampagne #IAMWHOLE für mentale Gesundheit einsetzt, oder Influencer Ben Hurst, der die Konversation zu den Themen Männlichkeit und Gleichberechtigung vorantreibt.
Weiters zählen Künstler wie Henry James Garrett, Sportler wie Josh Cavallo oder Schauspieler Justin Baldoni dazu. Sie alle streben aktiv die Konversation rund um das Thema an. Darüber hinaus gibt es Initiativen wie PositivMasc, The Joint Positive Masculinity Project oder Caring Masculinities in Action, die in Europa ins Leben gerufen wurden, um eine Welt zu gestalten, in der – so utopisch es auch klingen mag – toxische Männlichkeit einer positiven weicht.
Abonniere unseren EntreNousLetter und bleibe am neuesten Stand. Verpasse keine Updates über Mode, Kunst, Beauty & Lifestyle!