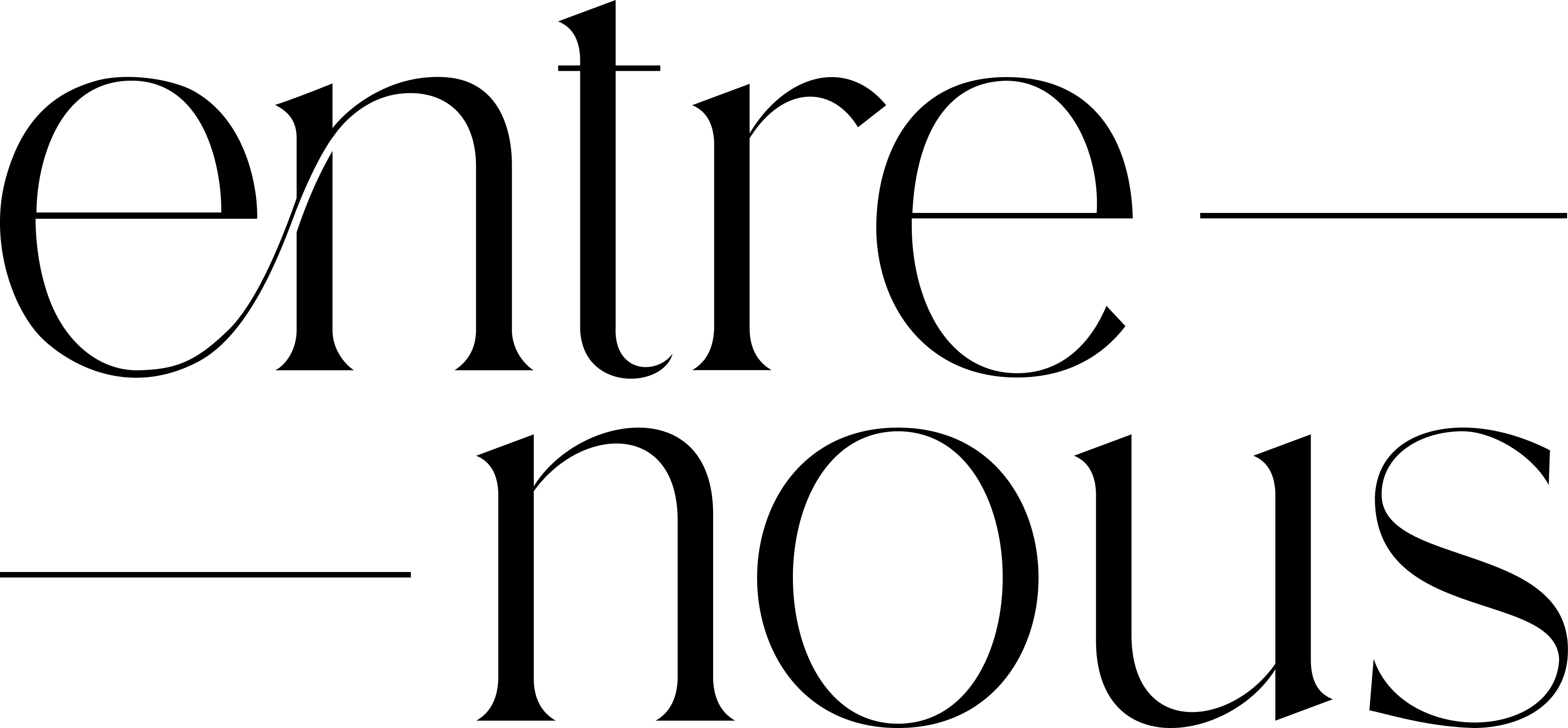Erst einmal die Hard Facts: „Call Her Alex“ ist eine zweiteilige Dokuserie auf Hulu, die am 8. Juni 2025 ihre Weltpremiere beim Tribeca Film Festival feierte und ab dem 10. Juni 2025 bei uns auf Disney+ gestreamt werden kann. Regie führte Ry Russo Young („Nuclear Family“)
Trigger-Warnung: Der folgende Artikel behandelt Themen wie sexuelle Belästigung und institutionelles Fehlverhalten, die für einige Leser:innen belastend sein könnten.
Alex Cooper kennt man – zumindest wenn man sich schon einmal mit Podcasts über Sex, Dating oder Popkultur beschäftigt hat. Auch als „Podcasterin ihrer Generation“ bezeichnet, hat sie mit ihrem Format „Call Her Daddy“ einen Nerv getroffen: schonungslos offen, aber auch immer wieder verletzlich. Was viele nicht wissen: Hinter der selbstbewussten Stimme steckt eine Geschichte. Und die hat es in sich.
In ihrer neuen Dokuserie „Call Her Alex“ (Premiere: 8. Juni 2025 auf Hulu/Disney+) geht Cooper einen Schritt weiter. Sie spricht nicht nur über Ruhm und Karrieresprünge, sondern auch über das, was sie jahrelang verdrängt hatte: ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung ihrer Fußballtrainerin – und das Gefühl, von ihrer Universität, der Boston University, damals nicht geschützt worden zu sein.
Hier ist der Trailer:
„Ich wurde nicht gehört“ – Alex Cooper
Die Vorwürfe richten sich gegen ihre frühere Fußballtrainerin Nancy Feldman an der Boston University. Laut Cooper habe es während ihrer Zeit im Team wiederholt unangemessenes Verhalten gegeben – von körperlichen Berührungen bis hin zu entwürdigenden Kommentaren. Sie sagt, sie habe sich klein gefühlt, ausgeliefert, und irgendwann habe sie ganz aufgehört, darüber zu sprechen. Noch schwerer wog für sie jedoch, dass – laut ihrer Aussage – niemand wirklich hingehört habe, als sie versuchte, Hilfe zu bekommen.
„Ich wusste nicht, ob ich überreagiere oder ob es wirklich falsch war“, sagt Cooper in der Doku. „Aber ich wusste, wie es sich angefühlt hat – und es war falsch.“
Alex cooper
Die Universität selbst hat bislang keine detaillierte Stellungnahme abgegeben. Nancy Feldman hat sich zu den Vorwürfen nicht öffentlich geäußert. Wichtig ist: Es handelt sich um persönliche Schilderungen – rechtlich ist niemand verurteilt. Die Aussagen Coopers basieren auf ihrer eigenen Erfahrung. Sie sind aber während der Vorfälle dokumentiert worden und Coopers Eltern haben es damals miterlebt und waren sogar bei der Besprechung der Universität mit dabei.
Sie ist übrigens nicht die einzige, die von Nancy Feldman belästigt worden sein soll. Es gab auch Beschwerden anderer betroffener Spielerinnen, die der Leitung der Boston University von Übergriffen der Fußballtrainerin berichtet haben. Das hat die Universität bisher nicht zu einer internen Untersuchung veranlasst, die sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert hat.
Warum die „Call Her Alex“-Doku wichtig ist
Was „Call Her Alex“ besonders macht, ist nicht nur der Mut zur Verletzlichkeit. Die Doku zeigt, wie aus einer jungen Frau mit einem populären Podcast eine öffentliche Person wird, die sich entschieden hat, Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst, aber auch für andere. Denn mit ihrer Geschichte gibt sie jenen eine Stimme, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sich vielleicht bis heute nicht trauen, sie auszusprechen.
„If being vulnerable makes people feel connected and seen, then I’m doing my job.“
Alex cooper
Dabei muss auch festgestellt werden, dass in diesem Fall (laut Cooper) eine Frau auf der Täterseite steht. Und genau das ist ein Aspekt, den wir als Gesellschaft endlich anerkennen sollten: Frauen können ebenso Sexualdelikte begehen wie Männer. Zwar zeigen Studien, dass Frauen in wesentlich geringerem Ausmaß als Männer solche Taten begehen, doch handelt es sich hierbei um einen blinden Fleck in unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung.
Frauen werden häufig als mütterliche, fürsorgliche Figuren gesehen – Vorstellungen, die mit sexualisierter Gewalt nicht in Einklang zu bringen scheinen. Doch genau darin liegt das Problem: Die fehlende Wahrnehmung weiblicher Täterinnen ist eng verknüpft mit gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen – und mit Vorstellungen darüber, wie sexuelle Handlungen „zustande“ kommen. Dies resultiert in einer (wissenschaftlich ausgedrückt) „phallo- und penetrationszentrierten Gesetzgebung“, die den Missbrauch auch mit einer „Triebabfuhr“ erklärt, weswegen bis heute Vergewaltiger fälschlicherweise damit „entschuldigt“ werden, sie hätten keine andere Möglichkeit gehabt, ihre „Triebe auszuleben“. Alleine Worte wie „Lustmörder“, die ein solches Verhalten verharmlosen, sind Euphemismus pur.
Doch weiter im Text.
Bis heute gibt es die gesellschaftlich vorherrschende Vorstellung, dass ein Sexualakt nur von einer Person ausgeführt werden kann, die über einen Penis zur Penetration verfüge.
Historisch drückte sich das in Österreich beispielsweise in „Homosexuellen-Paragraphen“ des Strafgesetzbuches aus, der bis 1971 nur homosexuelle Handlungen zwischen Männer unter Strafe stellte. Das war keine Sympathie der Gesetzgeber gegenüber lesbischen Frauen, sie konnten laut diesen einfach keinen Sex haben, da Frauen der „passiver Teil des Geschlechtsaktes“ in den gesellschaftlichen Vorstellungen der damaligen Zeit zugesprochen wurde und der „aktive Part“ einfach fehlte. (Anders war es allerdings während der NS-Zeit. Hier wurden auch homosexuelle Frauen sowie trans Personen verfolgt, inhaftiert und umgebracht.)
Doch auch heute ist das immer noch in vielen Ländern in der Kodifizierung ein Fokus auf den männlich zugeschriebenen Part zu finden.
In England und Wales beispielsweise, ist in der juristischen Definition von Vergewaltigung (Sexual Offences Act, 2003) ausschließlich von „peniler Penetration“ die Rede.
Das impliziert, dass nur Männer als Täter infrage kommen: „Female sexual offenders (FSOs) have generated less attention than male perpetrators. This is in part due to the criminal justice system’s male-dominated perception of sexual abuse. For example, the legal definition of rape in England and Wales concerns ‘penile penetration’ (Sexual Offences Act, 2003), implying that solely males can be responsible for rape.“ (Studie der National Law University Delhi)
Doch die Realität sieht anders aus
Warum Frauen als Sexualstraftäterinnen viel weniger erfasst werden, kann man sich nach meiner obigen Begrüdung vorstellen. Und dazu gibt es auch noch Studien und Fakten.
- Eine umfangreiche US-Studie (2010–2016) verglich gemeldete Sexualdelikte beider Geschlechter und stellte fest: Frauen wurden 42% weniger häufig festgenommen als Männer. (Studie veröffentlicht im Sage Journal)
- Daraus ergibt sich: Frauen machen etwa 1% aller inhaftierten Sexualstraftäter:innen aus. Doch wegen der niedrigeren Verhaftungsrate ergibt sich die Tatsache, dass wesentlich mehr Frauen sexualdeliktlich aktiv sind, jedoch nicht entdeckt werden.
- Frauen bekommen wesentlich mildere Strafen als männliche Täter.
Warum und wann begehen Frauen Sexualdelikte?
Das ist ein heikles Thema, was man jedoch aus Studien mit verurteilten Sexualstraftäterinnen weiß ist, dass ein hoher Anteil selbst Opfer (lt. University of Georgia) in jungen Jahren geworden sind. Die Rückfallquote nach Bestrafung bei Frauen fällt allerdings wesentlich geringer aus, als die bei Männern.
Abonniere unseren EntreNousLetter und bleibe am neuesten Stand. Verpasse keine Updates über Mode, Kunst, Beauty & Lifestyle!