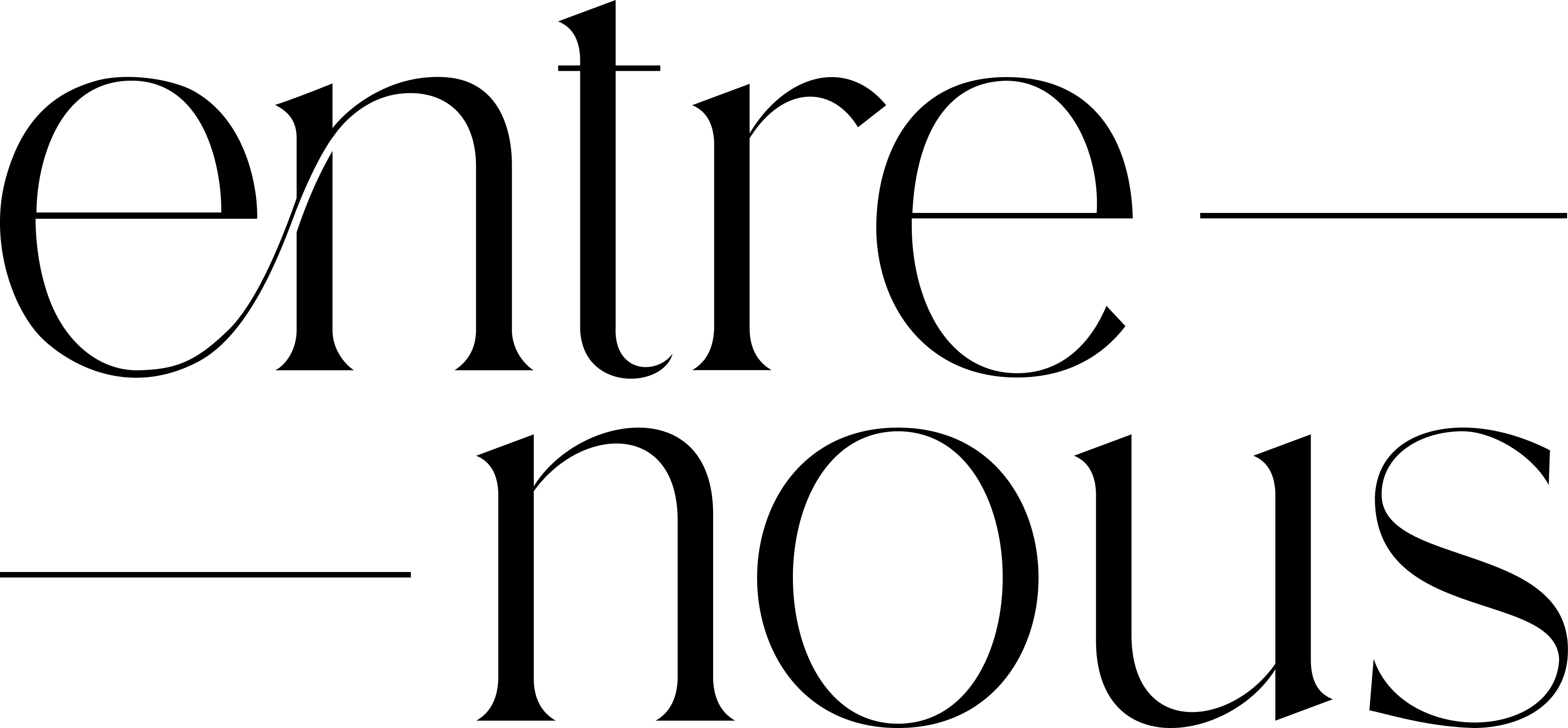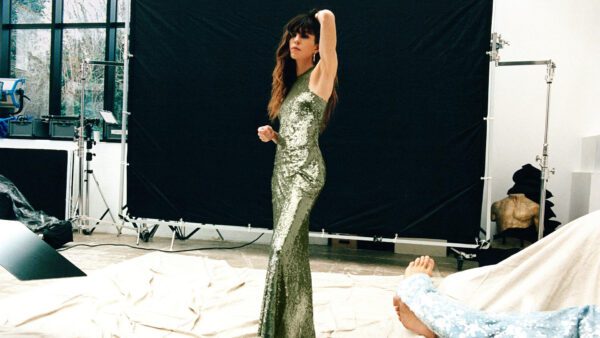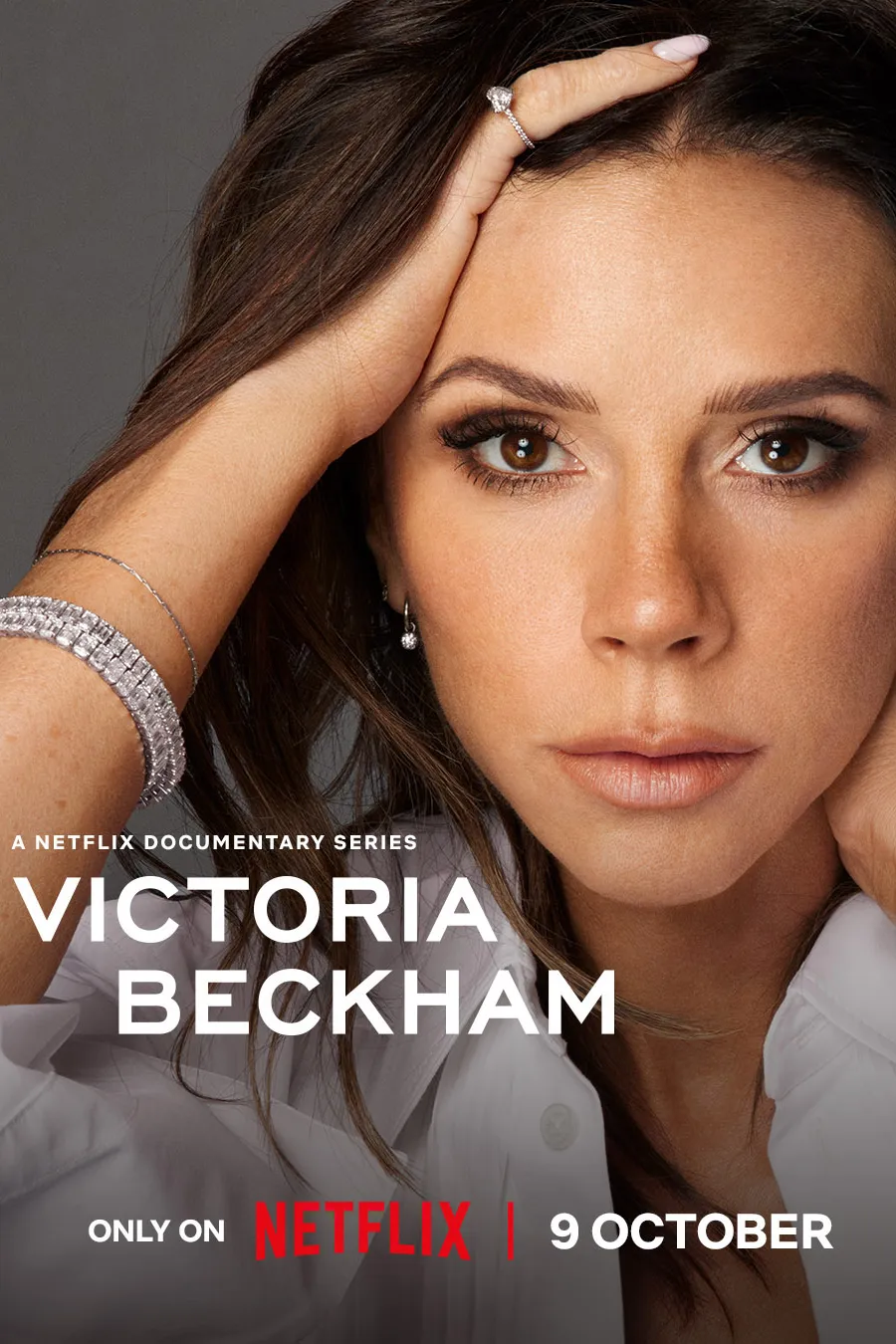
Auch wenn ich late to the party bin, hatte ich in den letzten Tagen Zeit, mir die 2025 auf Netflix erschienene Mini-Doku-Serie „Victoria Beckham“ anzusehen. Zunächst ist sie natürlich ein klassischer Fall der Markenpflege.
In drei Teilen führt sie uns durch Probenräume, Fittings, Glamour-Momente und Familienräume – von der Idylle im englischen Landhaus bis zur Bühne der Paris Fashion Week. Und gerade in dieser Doppelung – das private Refugium, die öffentliche Bühne – liegt ein subtiler Spiegel der heutigen Mode- und Markenwelt.
Wo ist hier das kuratierte Private und die öffentliche Bühne anfängt? Wir wissen es nicht, und es scheint, als wüsste die Hautprotagonistin es auch nicht.
Aber das macht nichts. Denn Posh Spice ist die Person, der man sehr viel verzeiht. Vielleicht auch deswegen, weil man mit ihr aufgewachsen ist und sie wie eine ferne Bekannte aus der Schule auf Instagram betrachtet, die es geschafft hat.
Was wir zu sehen bekommen, ist das „Making of“ einer Marke, die sich selbst als Designermarke versteht, sich aber auch als kulturelles Kapital inszeniert.
Die Welt, die gezeigt wird, ist makellos – durchdacht. Zu makellos, als dass man es ihr abkaufen würde. Von außen betrachtet wirkt sie wie das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit – okay, berechtigt – aber auch wie eine Konstruktion, in der Reibung kaum stattfinden darf. Und wenn Reibung auftritt – etwa in den wenigen Momenten, in denen Victoria über ihren Körper spricht oder über Kritik an sich –, dann wirkt das fast wie das bewusste „Einschalten“ des Bruchs im ansonsten glatten Narrativ.
Die Serie liefert durchaus Wertvolles: den Blick auf Mode als Handwerk, auf die minutiöse Vorbereitung einer Show und auf Familie als Teil des Markenkosmos. Doch was fehlt, ist das Moment der Unberechenbarkeit, das Chaos, das Ungeplante – jene Momente, die unsere Aufmerksamkeit wecken, weil wir ahnen: Hier wird etwas nicht nur gezeigt, hier wird etwas hergestellt.
Die hart arbeitende „Queen Victoria“
Ein besonders bemerkenswerter Aspekt: Die Serie thematisiert Disziplin, Kontrolle und Ästhetik – nicht als Nebenbemerkung, sondern als Grundmodus. In einer Szene spricht Victoria Beckham über Ess- und Körperbilder – seltenheitswertig ehrlich. Doch der Schnitt ist schnell wieder kopiert in die Szene des Teammeetings und der Showvorbereitung.
Hier gilt: Kontrolle = Überleben. Und das ist an sich keine falsche Erkenntnis – im Modemarkt und in der Celebrity-Marke gilt das doppelt. Aber wenn Kontrolle zur Hauptästhetik wird, verliert das Unfertige, das Fragile, seinen Platz und selbst die Stromschnellen, die in Form von Regengüssen vor einer Fashion-Show umschifft werden müssen, geben keinen dramatischen Moment ab. Man muss nur allzu gut: Queen Victoria wird auch das überstehen.
Wir sehen Erfolg, wir sehen Arbeit, wir sehen Marke, aber wir erleben wenig Zweifel, wenig Unordnung, wenig Risiko. Und gerade dieses Risiko – das Nicht-Glatte – ist heute selten geworden und doch genau das, was Marken glaubwürdig oder zumindest interessant machen kann.
In der Tradition eines klassischen Essays bleibt am Ende ein ambivalentes Fazit: Ich bewundere das Handwerk, ich erkenne die Leistung – und doch bleibe ich kritisch gegenüber dem, was nicht erzählt wird. Dass Marken Narrative überall mitschwingen lassen, ist nichts Neues. Doch wenn die Inszenierung so offensichtlich ist, dass jegliche Spannung herausgenommen wird, die die Protagonist:innen in echten Momenten authentisch und unkontrolliert erfahrbar macht, fällt bei mir der innere Rolladen.
Wenn ich mir schon eine Doku ansehe, dann lieber eine, die kratzt statt poliert. Da ist mir die Haftbefehl-Doku („Babo“) lieber, obwohl das Metier so gar nicht meines ist. Aber immerhin menschelt es da.
Abonniere unseren EntreNousLetter und bleibe am neuesten Stand. Verpasse keine Updates über Mode, Kunst, Beauty & Lifestyle!